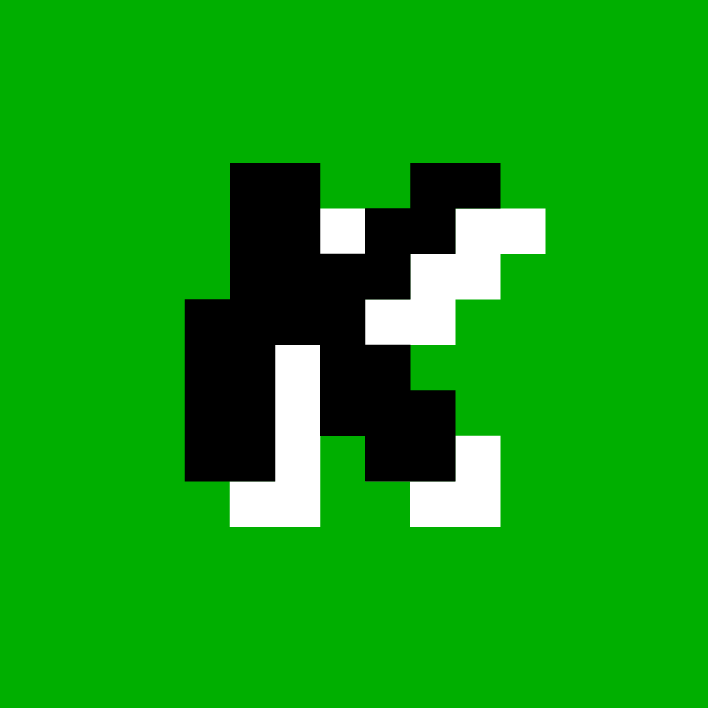Kultz und Transparenz
«Reden wir über Gemeinnützigkeit und Geld» steht im letzten Kultz-Brief und das kritische Publikum fragt sich: Was ist passiert? Waren sie in einem katholischen Beichtlager? Sind sie Philantrokapitalisten?
Roman Gibel — 09/29/20, 09:30 AM
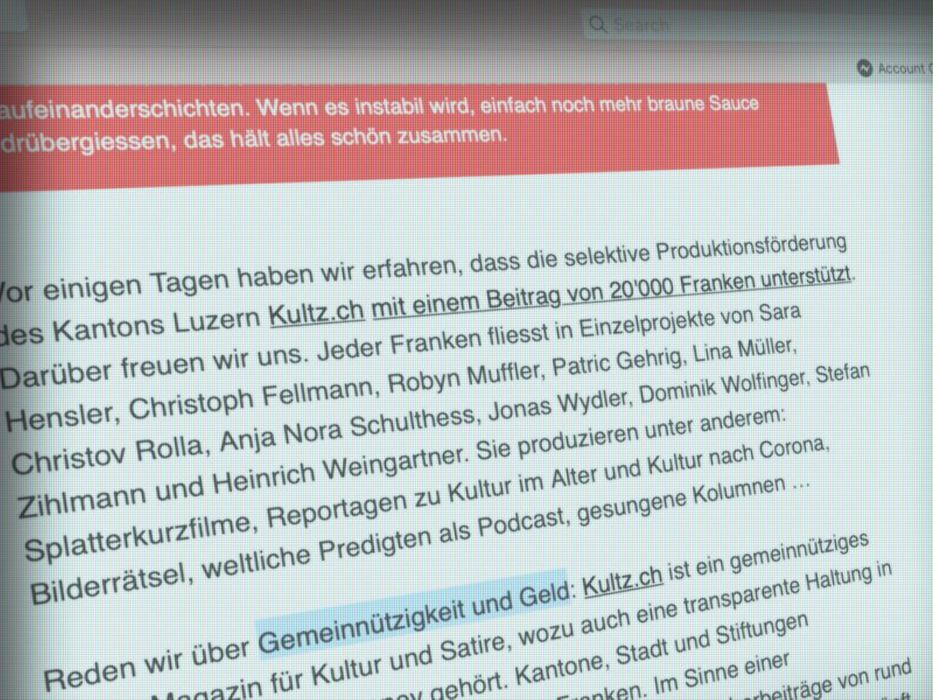
Während der Management-Sprech’ im Kultz-Brief mit Kalauern und Humor kaschiert wird, bleibt der Sinn dieser Zeile nicht verborgen: Kultz hat nichts zu verstecken, denn Kultz ist nicht böse, sondern gut. Das beweist Kultz, indem es transparent ist. Soweit, so gut. Aber was hat es eigentlich damit auf sich, dass auch ein Zentralschweizer (!) Online-Magazin plötzlich Narrative der Transparenz bedient?
Um diese Frage zu beantworten, muss etwas ausgeholt werden: Während Wissen und Information im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts ein Privileg der Geistlichkeit und der Gelehrtenkaste waren und auch Gerichtsverhandlungen nur zu Abschreckungsgründen öffentlich abgehalten wurden, nahm spätestens mit der Aufklärung der Drang nach Öffentlichkeit und Information zu (im wahrsten Sinne des Wortes: enlightenment bzw. lumières). Zunehmend wurde der Begriff der Transparenz positiv gefärbt – weil damit alteingesessene Autoritäten in Frage gestellt werden konnten.
Der französische Sozialphilosoph Michel Foucault identifiziert im 20. Jahrhundert die Disziplinierung als gesellschaftlichen Megatrend und stützt dies mit Beispielen der Überwachung und Kontrolle. Das Perfide dabei: Es braucht gar keinen Überwacher mehr, weil sich bereits jede und jeder selbst diszipliniert. Passend hierzu verwendet Foucault die Metapher des «Panopticons»: ein Gefängnisbau aus dem frühen 19. Jahrhundert, der die Insassen total sichtbar und damit leicht überwachbar machte. Heute ist Transparenz ein vielseitiges Phänomen. Einerseits wird rege offengelegt: Jahresberichte, Finanzströme, Ressourcenherkunft, ISO-Zeugs, Deklarationen und so weiter. Andererseits erinnern sich Schweizer Boomer mit Schaudern an die Fichenaffäre, das Sozialkreditsystem in China wäre das perfekte Black-Mirror-Szenario, wäre es nicht Realität und Datenkraken wie Google und Co. sorgen immer wieder für Aufsehen.
Der Diskurs um die eigene Privatsphäre und den Staat als Überwacher lebt weiter. Wieso aber wird in der Corporate World Transparenz derart positiv ausgelegt? Seit den 1970er-Jahren gehören Öffentlichkeitsabteilungen zum Must-have für Unternehmen, Smartphone-Apps attestieren Krankenkassen einen gesunden Lebensstil und sogar die Fifa lässt sich auf die korrupten Finger schauen (intern, haha). Bezeichnend für diese Entwicklung: Im Jahr 2014 fällt das Schweizer Bankgeheimnis und auf den Cayman Islands knallen die Korken, weil die Konkurrenz ausgeschaltet wurde.
«Kultz.ch ist ein gemeinnütziges Online-Magazin, wozu auch eine transparente Haltung in Sachen Moneymoneymoney gehört», steht im Kultz-Brief weiter. Transparenz wird so zum Auditing-Tool, also einem Diener zur Prüfung des Rechnungswesens. Sie ist damit nicht mehr nur werthaltig positiv konnotiert, sondern sorgt für eine Verbindung mit Effizienz- und Rationalitätskriterien, an denen mittlerweile auch Non-Profit-Unternehmen gemessen werden. Aus der Organisationsforschung ist bekannt, dass Organisationen ziemlich viel tun, was ihrem Profitziel eigentlich nicht dienlich ist, zum Teil gar zuwiderläuft. Sie tun es aber trotzdem, um legitim zu erscheinen. Für Transparenz bedeutet das demnach, dass entsprechende Bemühungen publikumsorientiert sind, um die Organisation zu legitimieren. Der Engländer und Accounting-Professor Michael Power geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet die Prüfung (also das audit) als konstitutives Element westlicher Gesellschaften. Kurzum: Immer mehr Bereiche des Alltags- und Wirtschaftslebens werden messbar und damit sichtbar gemacht.
Allerdings würde totale Transparenz zu Organisationsversagen führen: Informelle Wege in einem Unternehmen garantieren erst einen einigermassen flüssigen Lauf der Dinge. So war und ist der sogenannte Dienst nach Vorschrift nach wie vor eine sehr effektive Form von Streik. Ein Grund, weshalb diese informelle Seite so wichtig ist, sind widersprüchliche Erwartungen, die an Organisationen gestellt werden. So erwarten Anleger beispielsweise eine möglichst hohe Gewinnausschüttung und eine effiziente Betriebsführung, während die hauseigene CSR-Abteilung (Corporate Social Responsibility) lieber ein paar Bäume pflanzen würde. Aus diesen Konfliktfeldern entstehen Spannungen, die auf formaler Ebene kaum gelöst werden können und deswegen gerne, meist im Bewusstsein aller Beteiligten, umgangen werden.
Nicht jede Bemühung um Transparenz ist auf Fassadenpolitur und Legitimitätsgewinnung zurückzuführen. Insbesondere Organisationen, die starken ideellen Erwartungen ausgesetzt sind – wie zum Beispiel Gemeinnützigkeit – wollen und müssen erst recht integer und vertrauenserweckend wirken. Auch weil ihre Ressourcen direkt mit dieser Glaubwürdigkeit zusammenhängen. Im Gegensatz zu, sagen wir, einer Schraubenfirma. Das kann auch skurrile Züge annehmen. Im vergangenen Jahr verkündete der deutsche SPD-Finanzminister Olaf Scholz, dass Männerbünden wie Schützenvereinen oder Logen die Gemeinnützigkeit und damit die Steuerbefreiung aberkannt werden soll. Diese wehrten sich vehement. Nicht etwa, weil sie Vereinsvermögen schützen möchten (das ist bei diesen Bünden quasi inexistent), sondern weil ihnen so die selbstverschriebene Charity, also Existenzberechtigung, abgesprochen würde.
Aber zurück zu Kultz.ch, das zum Glück kein Männerbund ist. Vor gesellschaftlichen Erwartungen ist auch ein Kultur- und Satire-Magazin nicht gefeit. So ist neben Ulk, Spass und seriösem Journalismus eben auch das «audit» wichtiger Teil vom Ganzen. Ein Umstand, der bei grossen Medien-Joint-Ventures manchmal vergessen geht, hat man den Eindruck.
Roman Gibel lehrt und forscht an der Uni Luzern zu Transparenz und Organisationen. Er liebt Kultz.ch.