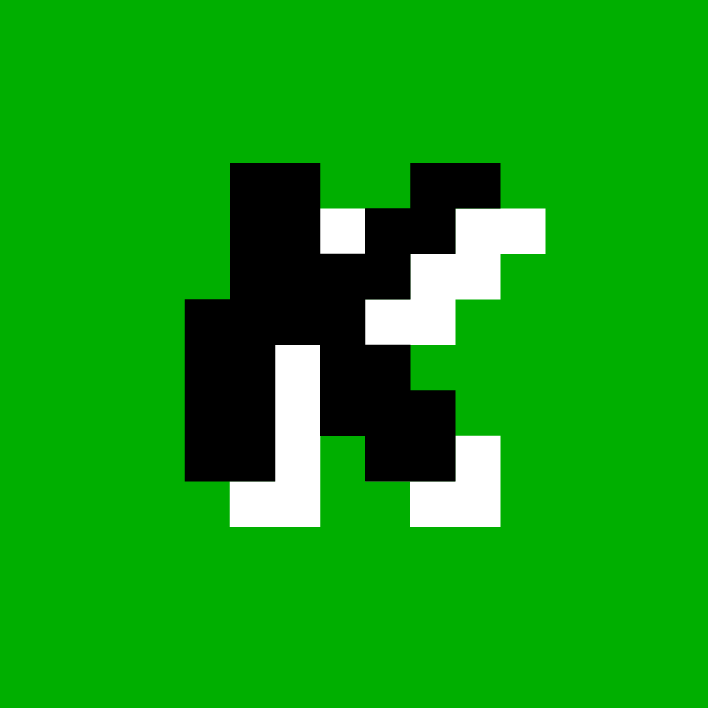25 Jahre «Scream»
Eine Ikone des Schlitzerfilms
«Scream» hat Filmen über mordende Messerstecher neue Impulse gegeben. Doch ist auch der neueste Film der Kult-Reihe den Kinobesuch wert?
Sarah Stutte — 02/04/22, 09:16 AM

Stichelt wieder: Nach 25 Jahren seit dem ersten Teil läuft nun ein neuer «Scream»-Film im Kino. Foto: Paramount Pictures
Seit den ausklingenden 1980er-Jahren dümpelte das Slasher-Subgenre mehr oder weniger vor sich hin. Dann kam es 1996 zu seiner überraschenden Wiederauferstehung: Wes Cravens «Scream» wurde zum Kassenschlager, weil er postmodernen Humor mit viszeralem Horror verband und mit der Nostalgie der Blütezeit des Slashers spielte. Ein Blick zurück und ins Kino, in dem gerade der neueste Teil der Reihe läuft.
Sein Goldenes Zeitalter erlebte der «Schlitzerfilm» zwei Jahrzehnte zuvor. In seiner modernen Form, wie wir ihn heute kennen, wurde er 1978 zum Leben erweckt, durch John Carpenters Low-Budget-Produktion «Halloween», in der Jamie Lee Curtis als das erste «Final Girl» überhaupt um ihr Leben rannte. Mit dem gefühllosen Serienkiller Michael Myers, der mordend durch die Nachbarschaft zog, hob Carpenter die bis dahin sicher geglaubte Welt der kleinstädtischen Idylle aus den Angeln.

Blaupause für den maskierten Mörder: Michael Myers in «Halloween». Foto: Universal Pictures
Nach dem ersten Boom, der grosse Franchises wie «Freitag der 13.» (1980, Sean S. Cunningham) und «A Nightmare On Elm Street» (1984, Wes Craven) hervorbrachte, flaute das Interesse Ende der 1980er-Jahre ab. Dies nicht nur, weil die Storys dem Genre nicht wirklich etwas Neues hinzuzufügen vermochten. Auch die zunehmende – vor allem in den USA und Grossbritannien – geführte Kontroverse um Gewalt in den Medien sowie der aufkommende Videomarkt waren dafür verantwortlich.
Dann kam 1996 Wes Cravens «Scream». Es war der Film, den das Genre für seine Existenzberechtigung und Weiterentwicklung dringend benötigte. Er machte sich die Tropen des Horrors zu eigen, nahm sich selbst auf die Schippe und versuchte etwas Neues zu kreieren, statt an etwas Ausgelutschtes anzuknüpfen. Dies gelang «Scream» indem der Film sein eigenes Regelwerk schuf, das die verschiedenen bis dato geltenden Horrorfilm-Klischees nicht nur einfach parodierte, sondern ganz anders in Szene setzte.

Zwischen Autoritätsperson und Witzfigur: Der Mörder mit der Gespenstermaske. Hier bei seinem ersten Auftritt anno 1996. Foto: Paramount Pictures
Bahnbrechend war deshalb auch die Figurenzeichnung. Fast alle Hauptcharaktere sind klug, witzig, schlagfertig, ehrlich und keinesfalls perfekt, weshalb sie dem Publikum auch gerade aufgrund ihrer Fehler ans Herz wachsen. Sie sind nicht derart austauschbar wie in anderen Horrorfilmen und bleiben spannend, weil sie an ihren Erfahrungen wachsen und so den Killern der Reihe ebenbürtige Gegner sind. Vor allem Sidney Prescott widersetzt sich mit ihrem Selbstbewusstsein und Mut ein ums andere Mal den Erwartungen des Publikums. Gerade diese andersartige Perspektive auf seine weibliche Hauptfigur trug wesentlich zur Wahrnehmung des Horrorgenres in der Populärkultur bei.
Auch die Darstellung des Killers in «Scream» unterschied sich massgeblich von derjenigen bisheriger Psychokiller. Ghostface hat einen grausamen Sinn für Humor, was sich in originellen Tötungsszenarien niederschlägt. Er scheint in seiner Mordlust mehr von willkürlichem Hass getrieben zu sein als von anderen Motiven, ist jedoch kein fehlerfreier Sadist, sondern manchmal auch ein wenig ungeschickt.
Seine Persönlichkeit spiegelt sich schon in den ersten zwölf Minuten von «Scream», die bis heute als kongeniale Horror-Eröffnungsszene gelten. Legendär ist inzwischen der spielerische Dialog zwischen dem Mörder und der kurz auftretenden Drew Barrymore, die nach ihrem Lieblingshorrorfilm gefragt wird und alles für einen schlechten Scherz hält.

Starke weibliche Hauptrolle: Neve Campbell als Sidney Prescott. Foto: Paramount Pictures
Das «der Killer ist im Haus» -Thema wurde 1974 das erste Mal im kanadischen Horrorfilm «Black Christmas» verwendet und war damals schon effektiv. Auch Scream-Drehbuchautor Kevin Williamson stellte diese Methode der Story voran, um von Anfang an das Publikum zu verunsichern, das unmittelbar in die Situation auf der Leinwand hineingezwungen wird und dieselbe Angst zu spüren bekommt wie das Opfer.
«Scream» und seine Nachfolger hatten noch etwas, was anderen Horrorfilmen bis dato meist fehlte: man konnte herzhaft lachen. Das war zum Teil den unterhaltsamen Figuren geschuldet, aber auch der Situationskomik, die immer auf den Punkt war. Amüsant waren natürlich auch die vielen Anspielungen auf berühmte Horrorfilm-Klassiker.
Sie motivierten dazu, den Film mehrmals zu sehen und in Dialogen, Charakternamen, Schauspielern, speziellen Kameraeinstellungen oder eingestreuten Szenen immer wieder neue Hinweise zu entdecken. Beispielsweise wie Wes Craven höchstpersönlich im Freddy Krueger-Gedächtnispulli den trostlosen Highsschool-Flur putzt oder Linda Blair aus «Der Exorzist» einen Cameo als Klatschreporterin hat.
Ein dramaturgisch sehr erfolgreiches Mittel der «Scream»-Reihe waren überdies die vielen Haken, die die Geschichte schlug. Man glaubte den Täter zu kennen, dann führte der Weg wieder ganz woanders hin. Jeder wirkte irgendwie verdächtig, bis uns am Ende die grosse Erkenntnis trotz allem kalt erwischte.
Ein blutiger Kassenschlager
Kurzum: Der raffinierte visuelle Stil Cravens verbunden mit dem cleveren Drehbuch von Kevin Williamson schaffte ein fantastisches Gleichgewicht zwischen den witzigen Subversionen und den erschreckenden Momenten von filmischer Mystik und Gewalt.
«Scream» wurde zum erfolgreichsten Slasher aller Zeiten und zog drei Fortsetzungen nach sich. Diese übertrafen zwar nicht die Brillanz des ersten Teils, setzten aber die Geschichte auf interessante Weise fort. Zudem ebnete «Scream» den Weg für zahlreiche Verästelungen im Genre, indem die Stoffe wieder mutiger und origineller wurden.

Gut gealtert: «Scream» vermag auch im fünften Teil zu überzeugen. Foto: Paramount Pictures
Gerade weil Scream inzwischen selbst zum Kult geworden ist, war die Angst vieler Fans gross, als bekannt wurde, dass zehn Jahre nach dem letzten Teil ein fünfter Ableger in die Kinos kommt. Der erste Film ohne Mastermind Wes Craven, der 2015 verstarb und mit einem Kevin Williamson, der diesmal «nur» als ausführender Produzent mit an Bord war. Doch der Film ist besser als erwartet.
Auf beeindruckend leichtfüssige Art und Weise verwebt er das Bewährte mit dem Frischen, die alten Regeln, nach denen man in einem Horrorfilm überlebt mit den neuen und nennt das Ganze Requel (ein Film, der irgendwo zwischen Fortsetzung, Reboot und Remake angesiedelt ist). Mit dem Titel, der schlicht wieder «Scream» lautet, sollte der Story und Craven Tribut gezollt, gleichzeitig der Geschichte aber auch ein eigener Stempel aufgedrückt werden.
Der Brutalitätspegel erreicht ungeahnte Höhen
Das gelingt nicht nur, indem altbekannte Motive aus den Vorgängern anders interpretiert werden, wovon vor allem die clevere Anfangssequenz zeugt oder die berühmte «Randy Meeks-Halloween-Szene». Auch in der Kameraführung wirkt dieser «Scream» frisch und elegant. Brett Jutkiewicz fängt den Killer auf eine Art und Weise ein, die sich besonders unwirklich anfühlt: als Silhouette vor Autoscheinwerfern etwa. Trotzdem ist selbst dieser Ghostface dann aber wieder genauso tolpatschig-ungestüm unterwegs, was ihn wiederum erdet.
Waren frühere «Scream»-Filme doch recht sparsam mit dem Blut, gibt es hier davon reichlich und der Brutalitätspegel erreicht ebenfalls ungeahnte Höhen. Weil das aber alles noch mit dem doppelbödigen Witz und auch der Liebe für das ureigene Genre erzählt wird, mit dem die Reihe massgeblich das Horrorgenre revolutionierte, hat man hier einfach wieder einen Heidenspass. Mit alten Freunden, neuen Gesichtern und dem ewigen Rätselraten, wer der Täter sein könnte.