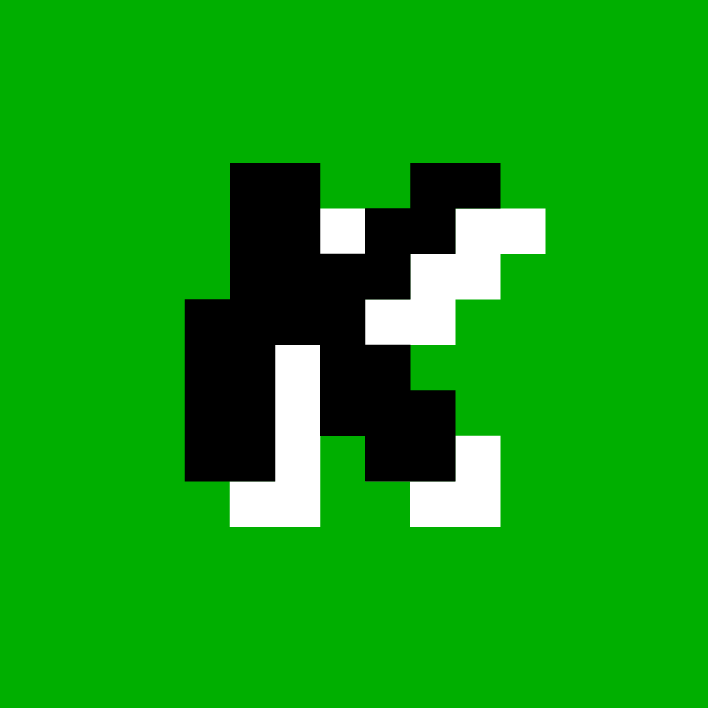Gegen die Karte im Kopf
Umherschweifen in Luzern
Was passiert, wenn man seinen gewöhnlichen Bewegungsradius durchbricht? Ist dadurch etwa die eigenen Stadt völlig neu zu entdecken? Nikola Gvozdic hat es ausprobiert.
Nikola Gvozdic — 06/29/22, 07:50 AM
Klar gegliedert und gradlinig: das Tribschenquartier. (Foto: Nikola Gvozdic)
Die Stadt, in der man lebt, ist nicht diejenige, die man im Kopf hat, wenn man an die Stadt denkt, in der man lebt. Die Stadt, die man im Kopf hat, setzt sich zusammen aus dem immer gleichen Arbeitsweg, dem Wohnquartier, den immer gleichen Routen zu den Läden, die man frequentiert, sogar die Spazierwege sind immer die gleichen. Die Karte der Stadt in unserem Kopf, ist eine komprimierte, zersplitterte und subjektive Version der Stadt. Die Wirkung der Geographie auf unser Empfinden und Erleben wird nicht hinterfragt.
Um dieser Rigidität entgegenzuwirken, entwickelte der Philosoph und wohl bekanntestes Mitglied der Situationistischen Internationalen Guy Debord die Theorie des Umherschweifens (Dérive). Grundsätzlich geht es bei einer Dérive darum, dass man sich durch einen urbanen Raum bewegt, wobei man versucht sich von seinen eigenen Vorstellungen zu lösen, und zu spüren, was dieser Raum mit einem macht. Man soll sich treiben lassen und Impulsen folgen, spielerisch erkunden und die Wirkung erfassen, die die Umgebung ausübt.

Der Startpunkt unseres Umherschweifers: Der Bahnhof.
An einem sonnigen Tag starte ich selber so einen Streifzug in Luzern. Ohne Handy, ohne Uhr und ohne klares Ziel, ausser mich den psychogeografischen Einflüssen hinzugeben, egal wohin sie mich führen, beginnt meine Dérive mit dem aussteigen aus einem halbleeren Bus am Bahnhof.
Ich begebe mich in die Halle hinein, stelle mich an den Rand und beobachte den Menschenfluss. Geschäftsleute, Touristen, Studenten, Schulklassen, Spazierende und Shoppende bewegen sich in einem geordneten Chaos. Hier ist ein klarer Angelpunkt, der mehrere Richtungen freigibt. Ich entscheide mich für die am wenigsten begangene, verlasse den Bahnhof nach hinten Richtung Universität und gehe nach oben über die Fussgängerbrücke.
Namensschilder neben Firmennamen. Baustellen, die alte Häuser verdrängen und neue Wohnformen anpreisen.
Wie ein Portal führt diese Brücke über die Gleise und Baustellen in ein ganz anderes Gebiet. Bei der Rösslimatt herrscht kein Chaos mehr. Aber irgendwie ist es auch nicht richtig harmonisch. Ein Hybrid, der weder klar Wohn- noch Arbeitsquartier ist. Namensschilder neben Firmennamen. Baustellen, die alte Häuser verdrängen und neue Wohnformen anpreisen. Die Zukunft scheint Arbeit, Wohnen, Bildung und Freizeit verschmelzen zu wollen. Ein Hoch auf die Work-Life-Living-Balance. Süsse Dystopie.
Eine sehr sterile Angelegenheit: Die Rösslimatt. (Foto: Nikola Gvozdic)
Im Tribschenquartier führen die Wege in geraden Linien zwischen den Häuserblöcken hindurch. Alles wirkt modern und modern-kühl, bis sich der Blick auf einen Kiesplatz öffnet, der als Spiel- und Fussballplatz benutzt wird. Es ist endlich ein Platz der authentisch und gebraucht aussieht und überhaupt nicht in diesen neuen, sauberen Lebensbereich passt.
Blickt man die Strasse entlang in Richtung Eisfeld sieht man, wie sie dort verschwindet. Die Bäume und die Kurve bilden ein gefühltes Ende, eine Grenze der Stadt, und treiben zurück in die Gegenrichtung. Statt zurück zu gehen lasse ich mich weiter den Rand entlang drängen.
Eine Treppe führt in ein ganz anderes Quartier nach oben. Ein versteckter, geheimer Weg, der ganz wegführt vom Trubel der Stadt. Es ist ruhig, kaum Menschen hier oben anzutreffen. Nur eine Schar Mauersegler zieht ihre wilden Kreise. Ein ruhiger Rückzugsort, oben auf dem Weinbergli, wohl angenehmer mit dem Auto zu erreichen, als zu Fuss oder im ÖV.
Stairway to Weinbergli. (Foto: Nikola Gvozdic)
Und plötzlich stosst man auf die St. Michael Kirche, die wie eine Festungsanlage aus einem der Weltkriege brutal das Gebiet überragt. Auch hier fühlt es sich wieder nach einer Grenze an. Ein Scheitelpunkt. Ich lasse mich runter treiben.
Die Strassen werden verschachtelter, Sackgassen sind plötzlich ein Problem. Nach einigen Kehrtwendungen finde ich den Weg hinaus. Wieder durch ein Portal und man landet unten im Neustadt-Voltastrasse-Gebiet. Ein Übergang, der sich nach Natur, Wald und keineswegs urban anfühlt. Eine Vorbereitung auf dieses Quartier, das deutlich lebendiger wirkt. Pflanzen wuchern wilder, die Häuser haben mehr Charakter. Menschen tummeln sich umher. Von irgendwoher erklingt Gelächter. Ein krasser Kontrast zum verschlafenen Wohnquartier oben.
Das Portal zur Neustadt. (Foto: Nikola Gvozdic)
Und so landet man an der Obergrundstrasse, einer pulsierenden Blutbahn der Stadt. Durch sie fliesst die Hektik der Stadt. Vorbei an verranzten Villen, Baustellen, Läden, Restaurants. Ein Fluss, der sich zuerst am Pilatusplatz und dann am Kasernenplatz wieder trennt.
Es sind keine weltbewegenden Erkenntnisse, die sich mir während meines Versuchs offenbarten. Was ich erkenne ist, dass viel mehr Stadt und viel mehr Erfahrungsmöglichkeiten vorhanden sind, wenn man nur genau hinsieht. All die unbemerkten Kräfte, die unsere Wahrnehmung beeinflussen können erfasst werden.
Es ist überraschend, wie distinkt sich die verschiedenen Gebiete Luzerns voneinander unterscheiden.
In diesem Umherschweifen habe ich mich an die Grenzen treiben lassen. Und so erfahren, dass es überhaupt etwas gibt, was ich hier als Rand und Grenze empfinden kann. Ich war in Quartieren, die nicht ganz so leicht zugänglich sind und solchen, die ganz offen daliegen. Es ist überraschend, wie distinkt sich die verschiedenen Gebiete Luzerns voneinander unterscheiden. Wie viele andere psychogeografische Wirkungen bleiben unbemerkt? Und wie stark muss man sich gegen die Karte im Kopf wehren?