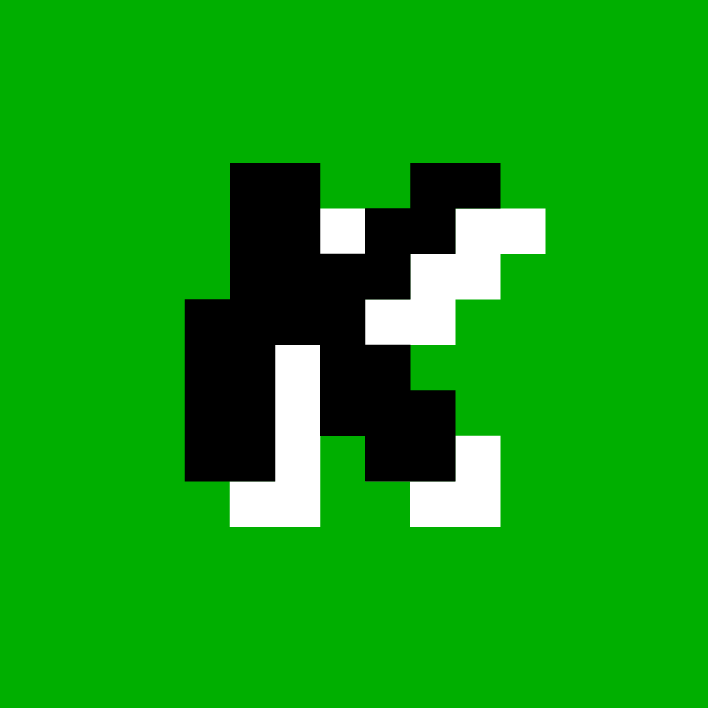Raubkunst in der Innerschweiz
Alles nur geklaut?
Immer wieder machen Kunstsammlungen Schlagzeilen, weil die Verantwortlichen verdrängen, woher ihre Schätze stammen. Wie sauber ist das Inventar der Zentralschweizer Museen?
Jana Avanzini — 01/21/22, 07:32 AM

Geschäfte mit den Nazis: In Luzern wurde mitgeholfen, «entarteter Kunst» weiterzuverkaufen. Hier im Bild: Joseph Goebbels in einem Berliner Museum. Foto: zvg
Auf einem Luzerner Dachboden wurde etwas gefunden, das nicht dort sein sollte. Es sind Ledermalereien, mehrere Meter gross. Kinder verschanzen sich hinter einer Palisade, ein Puma verfolgt ein Kaninchen, während spanische Offiziere das Apachendorf angreifen.
Die gezeigte Szenerie wurde im frühen 18. Jahrhundert in Santa Fé auf Büffelhäute gemalt. Doch wieso verstaubten die Werke lange auf einem Luzerner Dachboden, anstatt in einem indigenen Museum zu hängen? Schuld daran ist ein Luzerner Missionar. Philipp Segesser wollte im 18. Jahrhundert seinem Bruder ein paar «Kuriositäten» aus dem exotischen Mexiko schicken. So verschwanden die Malereien von der Bildfläche.
Dabei wären sie kunstgeschichtlich bedeutsam, völkerkundlich eine wichtige Quelle und künstlerisch relevant. Erst Gottfried Hotz vom ehemaligen Indianermuseum in Zürich barg die Werke aus ihrem staubigen Versteck. Ihre volle Pracht war jedoch längst verronnen. In die Büffelhäute wurden Fensterlöcher geschnitten, sie hatten wohl als Tapeten gedient.
Nazis und Kolonialmächte
Die bemalten Büffelhäute sind nur ein Beispiel, wie ausländische Kunstwerke auf suspekte Weise in der Zentralschweiz gelandet sind. Raubkunst hat hier schon beinahe Tradition. So arbeitete der Luzerner Auktionator Theodor Fischer mit dem Nazi-Regime zusammen und versteigerte «entartete Kunst» aus Deutschland im Grand Hotel National.
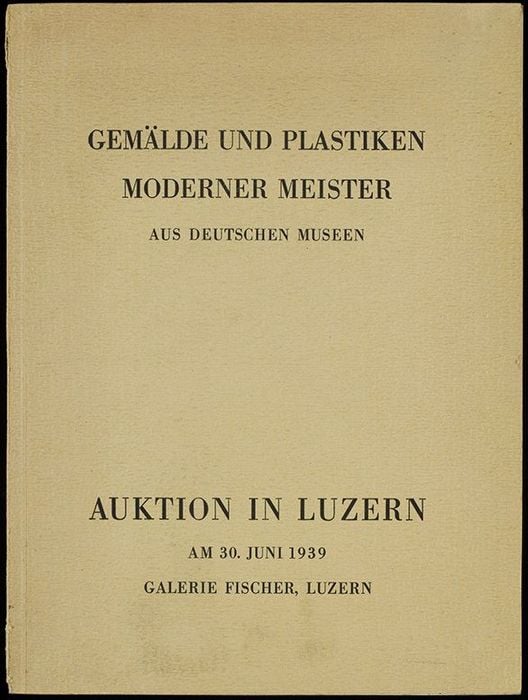
Der Luzerner Auktionator Theodor Fischer war eine der zentralen Figuren beim Handel mit NS-Raubkunst in der Schweiz. Foto: zvg
Doch wie steht es heute um das Inventar der Zentralschweizer Ausstellungsorte? Ist Kunst inzwischen unbedenklicher geworden? Das lässt sich nur schwer sagen. Denn viele Museen tun sich schwer mit der moralischen Aufarbeitung ihrer Bestände. Dabei gäbe es guten Grund dafür. Gemäss Schätzungen von Experten sollen sich 90 Prozent der afrikanischen Kulturgüter ausserhalb des Kontinents befinden. Hauptsächlich in europäischen Museen und Sammlungen. Und auch wenn die Schweiz keine Kolonialmacht war, hat sie doch massiv mitgeholfen und davon profitiert. In zahlreichen Sammlungen und Schweizer Museen – besonders Völkerkundemuseen – sind Objekte ausgestellt, bei denen die historische Verantwortung nicht wahrgenommen wird.
Schweigen im Historischen Museum
Im Historischen Museum Luzern hat zwar eine gewisse Vergangenheitsbewältigung stattgefunden. Mit welchem Ergebnis, ist jedoch unklar. Bestimmte Teile der Sammlung wurden überprüft. Die Details dieser Überprüfung sind jedoch nicht öffentlich und Almut Grüner, Leiterin der Kantonalen Museen Luzern, hat auf keine unserer Nachfragen reagiert.
Museen, die ihre Werke überprüfen lassen, konnten in den vergangenen Jahren auf die finanzielle Unterstützung des Staates zählen. So hat der Bund zwischen 2016 und 2020 rund zwei Millionen Franken in die Provenienzforschung investiert, also in die Forschung nach der Herkunft gewisser Kunstobjekten. Jeweils zur Hälfte übernahm der Bund dabei die Nachforschungen, die andere Hälfte mussten die Museen selbst aufbringen.
Von diesen Subventionen des Bundes profitierte 2016 auch das Kunstmuseum Luzern. Besonders einige Schenkungen wurden unter die Lupe genommen, rund 70 Werke wurden überprüft. Der damalige Kurator Heinz Stahlhut hatte sich dafür eingesetzt und sich während des Prozesses der Sammlungsaufarbeitung mit vielen anderen Kurator*innen über Vorgehen und die Ergebnisse ausgetauscht.
Angst vor schlafenden Hunden
Das Büro von Heinz Stahlhut im Hans Erni Museum, wo er heute als Leiter tätig ist, steht voller Kunst und prall gefüllter Ordner. Von der Minigolf-Anlage klingt übermotivierter Eurodance herüber. Der Kunsthistoriker betont als Erstes, es lohne sich, in der Provenienz proaktiv zu werden. Bei einigen Sammlungen und Museen bestehe die Angst, schlafende Hunde zu wecken, sagt Stahlhut aus Erfahrung. Doch irgendwann müsse man sich dem Thema stellen. Dann sei es besser, dass der Anstoss nicht von aussen komme. Denn das Thema werde in den kommenden Jahren eine immer grössere Präsenz einnehmen.
«Es ist schlicht nicht mehr vertretbar, sich auf die Gesetze von damals zu berufen»
Heinz Stahlhut, Leiter Hans Erni Museum
Früher sei der Handel mit kolonialen Kulturgütern als legal angesehen worden, sagt er. Man habe ohne Gedanken Mumien und Elfenbein verschoben, und noch heute liegen solche Objekte haufenweise in privaten Sammlungen. «Heute hingegen ist es schlicht nicht mehr vertretbar, sich auf die Gesetze des Handels von damals zu berufen», so Stahlhut.
Religiöse Motive
Laut Stahlhut muss man sich gerade bei Söldnern und Missionaren die Fragen stellen: War das Objekt ein Geschenk, von einem befreundeten Häuptling zum Beispiel, oder wurde ein Volk über den Tisch gezogen und beispielsweise mit einer Waffe für einen Haufen Kunst abgefertigt? Zudem müsse man beachten, merkt Stahlhut an, dass Missionare oft zusätzliche Motivationen für das «Mitnehmen» von Kulturgütern hatten. «Es ging teilweise auch darum, Stämmen ihre heidnischen Altertümer wegzunehmen, damit sie nach der Abreise der Christen nicht wieder einen ‹Rückfall› in ihre alte Religion erleiden.»
Man müsse den Geschichten nachgehen, die Hintergründe und Wege der Kunstobjekte aufzeigen. «Viel seltener als man meint, geht es um die Rückgabe der Objekte», sagt Stahlhut. Es müsse eine gerechte Einigung gefunden werden: «Es kann sein, dass Objekte zurückgefordert werden, nur Teile, oder dass man ein Objekt klar als Dauerleihgabe vermerkt und mit Informationen die koloniale Geschichte des Werks kommuniziert.»
Fragen zu Kriegsmaterial
Das Nidwaldner Museum hat vor ein paar Jahren die ganze Sammlung auf heikle Inhalte hin analysiert. Da diese jedoch hauptsächlich aus regionaler Kunst und hiesigen historischen Objekten besteht, sei man nicht auf verdächtige Stücke gestossen, sagt Sammlungskuratorin und baldige Leiterin des Nidwaldner Museums, Carmen Stirnimann. Sollten sich in Zukunft trotzdem bei einem Objekt Zweifel ergeben, müsste man das sofort transparent behandeln.

Wie kam dieser Schild ins Nidwaldner Museum? Foto: zvg
Und tatsächlich entwickelt sich in Gesprächen mit Kultz das Bestreben, eine Objektgruppe mit kolonialer Vergangenheit vertiefter anzuschauen, die bisher noch zu wenig im Fokus stand. Es handelt sich um den Nachlass des Nidwaldner Söldners in holländischen Diensten, Louis Wyrsch, – der sogenannte «Borneo Louis».
So liegt in der Sammlung zum Beispiel ein Schild mit einer breit lachenden Figur, mit verschiedenfarbigen, kreisrund umrandeten Augen und Brustwarzen. Ein Dämon, wie er häufig auf Schilden des Volks der Dayak auf der Insel Borneo vorkam, beschreibt es der Historiker André Holenstein. Doch was bewog «Borneo-Louis», diesen Schild sowie Speere, Blasrohre und Textilien mitzubringen? Wie hatte er sie erworben. Waren es Trophäen, Beute-Stücke, Geschenke oder Käufe?
Immer noch rassistische Vorurteile
Die Geschichte eines Objekts so weit wie möglich zu dokumentieren gehöre definitiv zum Bildungsauftrag eines Museums heute, sagt Museumsleiterin Stirnimann. Man wolle ja möglichst viel über die Objekte und darüber, was sie uns über die Geschichte sagen, wissen und vermitteln. «Deshalb ist es wichtig, genau hinzuschauen.»
Mit diesem genauen Hinschauen tut man sich in der Zentralschweiz teils schwer – obwohl die kolonialen Verflechtungen der Zentralschweiz kein Geheimnis sind. So streitet man sich teilweise noch intensiv darüber, unter welchen Umständen Missionare oder Söldner Kunst- und Kulturobjekte «erworben» haben. Dabei entwickelt sich oft ein politischer oder moralischer Diskurs, auch einer, der noch immer von rassistischen Vorurteilen geprägt ist. So werden beispielsweise afrikanischen Staaten in diesem Zusammenhang oft die Kompetenzen oder die finanziellen Mittel abgesprochen, sich um die – wohlgemerkt – eigenen kulturellen Schätze kümmern zu können.
Dazu merkte die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy in einem Interview an: «Wenn mir jemand meinen Mercedes klaut und ihn mir zurückgeben will, dann kann er nicht voraussetzen, dass ich mir zuerst eine Garage baue; denn es ist mein Mercedes.» Diese Veranschaulichung sollten wir in Europa verinnerlichen.