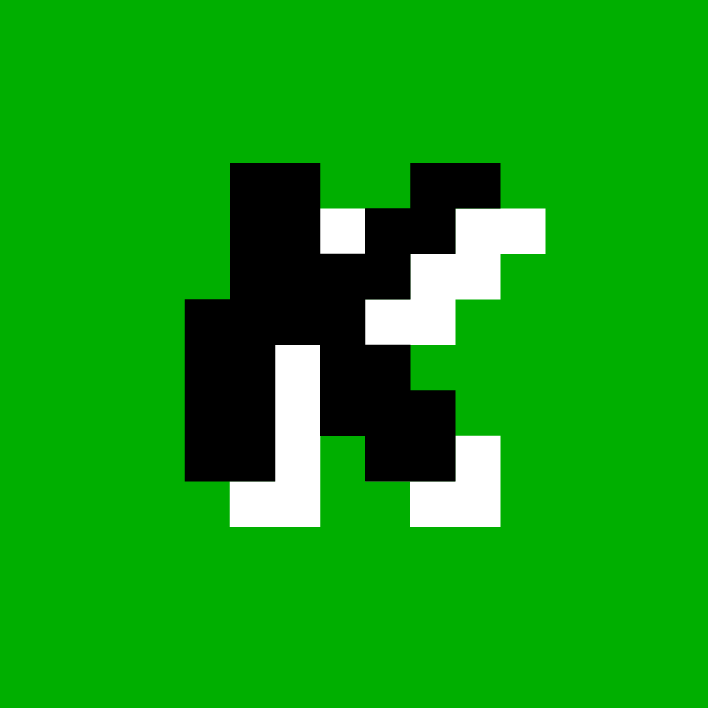Suiziddrohung im Live-TV
Aufforderung zum Wahnsinn
Das Luzerner Theater lädt mit «Network» zu einem Abend vor dem Abgrund ein. Die zeitgenössische Inszenierung schwingt zwischen emotionaler Verzweiflung und glasklarer Gesellschaftskritik.
Anton Kuzema — 04/05/22, 04:11 PM

Mit «Network» gelingt dem Luzerner Theater eine temporeiche Inszenierung. (Fotos: Ingo Hoehn)
Das Stück steigt explosiv ein. Die Zusammenfassung der ersten fünf Minuten: Howard Beale droht, sich in seiner nächsten und letzten Sendung den Kopf wegzublasen. Dadurch will der Nachrichtensprecher verhindern, dass er wegen sinkender Einschaltquote abgesetzt wird. Eine drastische Massnahme, die funktioniert. Seine Quote steigt abrupt wieder an.
Anstatt vor laufender Kamera Suizid zu begehen, hält Beale eine zornige Rede über die katastrophalen Verhältnisse in der Medienlandschaft. Seine ehrliche und unverfrorene Art, Kritik zu üben, begeistert das Publikum und befördert ihn zur Galionsfigur der Unzufriedenen. Von nun an bekommt der zornige Prophet einen Sendeplatz für seine Wutreden.
Auch in der restlichen Laufzeit wird im Luzerner Theater kaum einmal der Fuss von Gas genommen. Die Theateradaption von «Network», einem Satirefilm von 1976, verliert nur selten an Tempo.
Diktatur des Jingles
Die Ästhetik von Kostüm, Maske und Bühnenbild (Magdalena Gut) übernimmt die zeitliche Einordnung. Oder besser die Nicht-Einordnung: Einerseits Plateau Stiefel mit Absätzen, neonfarbene Bühnenelemente, klischierte Sitcom -Bewegungen. Alle rauchen die ganze Zeit. Andererseits raumschiffartige Uniformen, Smartphone Umhängebänder und zeitgenössische Tanzbewegungen. Das Stück möchte nicht zeitlich eingeordnet werden. Denn der Quotenfetisch der Nachrichtenmedien scheint zeitlos zu sein und kein baldiges Ende zu haben.
_0.jpg)
Ein Ankerpunkt in die Gegenwart sind die Selfie-Aufnahmen der Darsteller*innen. Diese werden auf eine hängende Leinwand projiziert und geben der Darstellung durchgehend einen Mediencharakter. Und das Stück hat einen Rhythmus: Die verworrene Masse aus Darsteller*innen wird von einem klassischen Nachrichten-Jingle beherrscht, der zwischen dem elektronischen Soundbild diktiert, wann Showtime ist.
Der Produktionsapparat als Organismus
Howard Beale wird von allen Darsteller*innen gespielt. Genauso wie jede andere Rolle. Sie bewegen sich quasi die ganze Zeit als innerlich zerrissene Einheit aus Nachrichtensprecher und Produktionsapparat über die Bühne. Obwohl diese Art der Darstellung anfangs befremdlich wirkt, und auch in gewisser Hinsicht bleibt, ist sie genau das, was dieses Stück braucht.

Die hektischen Prozesse innerhalb des «Networks» – also des Nachrichtensenders – werden in seiner Impulsivität und seinen internen Richtungswechseln unter den Darsteller*innen aufgeteilt und überzeugend bespielt: Gegenseitige Anschuldigungen, Machtkämpfe, Interessenkonflikte und die Einigkeit darüber, dass es um Einschaltquoten geht. Das wirkt konstant, wie ein verzweifeltes Um-sich-schlagen. Bei der gelungenen Inszenierung stellt sich fast nur die Frage, ob nicht mehr ruhige Momente für eine ausgeglichene Darstellung von innerem Chaos gesorgt hätten.
Krise der Kritik
Die zornigen Predigten von Howard Beale schaffen es eine tiefgehende Gesellschaftskritik frei von Plattitüden zu formulieren. Es finden sich einige passende Zitate aus dem Repertoire der Weltliteratur und Elemente von epischem Theater. Der Spiegel wird dem Publikum wortwörtlich vorgehalten, als eine Aufnahme der Zuschauer*innen kurz auf die Leinwand projiziert wird.
Das Stück erklärt, dass es den Moment des Wahnsinns braucht.
Doch dieser Aspekt bleibt unumgänglich paradox: Das Stück erzählt eine Geschichte darüber, wie Kritik für kommerzielle Zwecke vereinnahmt wird. Statt den Status Quo zu stören, unterstützt sie ihn sogar, wie im Stück dargestellt wird. Gleichzeitig sitzt man in einem Staatstheater, das kommerziell agiert und bejubelt den kritischen Moment, um danach wieder in den Alltag zurückzukehren. Doch selbst das kann durch eine parodistische Showeinlage ironisch diskutiert werden.
Die schrille und laute Inszenierung ist ein unglaublich wichtiges Stück. Es stellt uns vor die Frage, wie Kritik noch produktiv betrieben werden kann. Auch vor dem Hintergrund des Wahnsinns und des Zorns. Es wird erklärt, dass es den Moment des Wahnsinns braucht. Denn wer ist hier eigentlich wahnsinnig: Diejenigen, die das Weltgeschehen wahnsinnig macht oder diejenigen, die vor dem Abgrund stehen und unberührt bleiben?
Informationen zu weiteren Aufführungsdaten findest du hier.