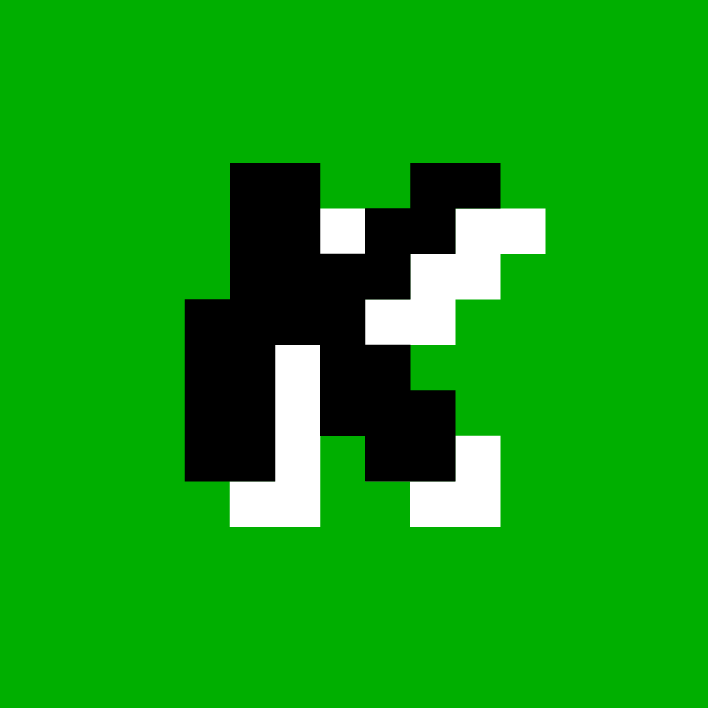Projekt Nachtleben
Wer an den Luzerner Clubtüren das Sagen hat
Lange Nächte und aggressive Kundschaft: Türsteher*innen haben einen schwierigen Job, für den sie oft angefeindet werden. Wir haben mit ihnen über ihre Erfahrungen gesprochen.
Lisa Kwasny — 10/31/22, 09:30 AM
.jpg)
Luca (Klub Kegelbahn), Sol (Neubad) und Nicole (Rok) arbeiten alle an der Clubtür. (Fotos: Lisa Kwasny)
Samstagabend, unterwegs auf den Strassen Luzerns. Bei der Kantonalbank-Bushaltestelle geht eine Gruppe junger Leute eilig vorbei. Sie scheinen genervt. «Diese Scheiss-Türsteher haben das Gefühl, ihnen gehöre die Welt», sagt einer der Gruppe wütend. Klingt, als wurde er gerade an einer Clubtür abgewiesen.
Diese Szene macht eines deutlich: Türsteher*innen haben einen Job, der ihnen nicht immer Sympathie entgegenbringt. Wer sind die Menschen, die die Türen der Luzerner Clubs regulieren? Warum lassen sie manche Leute nicht rein? Und was machen sie, wenn die Clubs in den frühen Morgenstunden schliessen?
Muttergefühle vor der Clubtür
«Wenn jemand nicht in den Club kommt, dann ist die Person entweder zu jung, zu betrunken oder sie verhält sich in der Schlange unangenehm», sagt Nicole. Als Selektorin vom Rok an der Seidenhofstrasse entscheidet sie darüber, wer in den Club rein darf. «Wir müssen schauen, dass der Club safe für alle ist und dass die Stimmung stimmt.» Kleidung sei ebenfalls ein Selektionsgrund, wenn auch nur ein kleiner: «Wenn jemand an einer Hiphop-Party im Jumpsuit kommt, ist das cool. Aber an einer House-Party sollte man wenigstens Jeans tragen.»

Nicole arbeitet an der Rok-Tür und sieht ihr Geschlecht in heiklen Situationen als Vorteil.
Doch was, wenn die Anstehenden die Hausregeln nicht akzeptieren wollen? In solchen Situationen empfindet Nicole ihr Geschlecht als Vorteil. «Wenn ein männlicher Türsteher männliche Gäste nicht reinlässt, fangen die gleich an, sich aufzuplustern und ihr Revier zu markieren. Bei mir können sie das nicht so gut.»
«Ich schreie nie.»
Nicole, Selektorin im Rok
Dennoch: In solchen Situationen ruhig zu bleiben, sei nicht einfach. Deshalb findet Nicole, dass nicht alle für die Arbeit vor der Tür gemacht seien. Sie spricht von einer ausgewogenen Mischung aus Freundlichkeit und Konsequenz. «Ich versuche, immer zu reden, ich schreie nie. Aber manchmal muss man einfach klar sagen, was nicht geht. Das kann ich gut», sagt sie und lacht. «Teilweise fühle ich mich wie eine Mutti, die ihre Kinder zurechtweist. Die Arbeit an der Tür ist eigentlich auch Care-Arbeit.»
Viermal pro Woche ins Fitness
Im Vergleich zu den Ausgangsmetropolen dieser Welt sind die Anstehschlangen im kleinstädtischen Luzern kurz. Hier passiert es kaum, dass man zwei Stunden in der Schlange steht, nur um am anderen Ende mit einem Kopfschütteln in die Nacht gespült zu werden.
Anders in Berlin. Wer beispielsweise ins Berghain gelangen will, wird zwangsläufig viel Zeit vor der Clubtür verbringen. Der Eingang vom berüchtigten Technotempel wird von Sven Marquardt überwacht. Er entspricht dem absoluten Stereotyp eines Türstehers, ist trainiert, tätowiert und unglaublich hart. Sätze wie «Heute leider nicht» sind sein Markenzeichen. Viele haben Angst vor ihm.
«Früher musste man gross und stark sein.»
Arsim, langjähriger Türsteher
Das Bild der angsteinflössenden Türsteher*innen sieht Arsim als überholt. Eigentlich ist er Logistiker, arbeitet aber seit ein paar Jahren jedes Wochenende an der Tür eines Luzerner Clubs, dessen Namen er aber nicht öffentlich machen will. «Früher musste man gross und stark sein. Heute ist es wichtig, wie man mit den Leuten umgeht.»
Darunter versteht Arsim beispielsweise, dass man mit den Gästen auch lachen und Witze machen kann. Der Spass hat jedoch auch seine Grenzen. «Manche Leute sind betrunken oder auf Drogen und wollen nicht zuhören. Dann bin ich auch nicht nett.» Weil gewisse Gäste aggressiv sein können, erfordert der Job an der Türe auch Körperkraft. Arsim trainiert drei- bis viermal pro Woche im Fitness-Center. Dazu komme Training zum Eingriff bei Gewaltsituationen.
Das Bauchgefühl spielt mit
Grundsätzliche Verhaltensregeln gibt es in allen Luzerner Clubs. Einige, vor allem alternative Clubs, gehen aber noch weiter. Das Neubad hat keine Türsteher*innen, sondern ein Awareness-Team.

Sol vom Neubad-Awarenessteam will mit gezielten Gesprächen Probleme verhindern, bevor sie überhaupt entstehen.
Sol gehört zu diesem und erklärt das Konzept folgendermassen: «Es geht um das Wohlbefinden der Menschen im Club.» Das heisst, das Awareness-Team geht präventiv auf Leute zu, wenn es denkt, dass ein Gespräch nötig ist. Das passiert zum Beispiel, wenn sich Personen durch andere bedrängt fühlen und wenn Grenzen nicht respektiert werden.
«Manchmal gebe ich jemandem eine Chance und merke dann, dass das ein Fehler war.»
Sol, Awareness-Team Neubad
Dieses Konzept wird am Eingang erklärt. «Wenn eine Person nicht zuhört oder nicht gewillt scheint, da mitzumachen, lassen wir sie nicht rein», sagt Sol. Das sei oft eine Entscheidung nach Bauchgefühl, die nicht immer einfach ist: «Es ist herausfordernd, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person einen unangenehmen Vibe hat, es aber übertrieben wäre, sie direkt rauszuschmeissen.» So kann es durchaus vorkommen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. «Manchmal gebe ich jemandem eine Chance und merke dann, dass das ein Fehler war.»
«Das muss man halt aushalten können»
An anderen Orten geht man mit Übergriffigkeit weniger präventiv um. Zum Beispiel im Franky an der Frankenstrasse. «Wenn eine Frau zu mir kommt, weil sie sich bedrängt fühlt, werfen wir den Gast raus», sagt der dortige Türsteher. Das ist aber gewissermassen eine Bringschuld. «Sie muss aber halt auch den Mut haben, Nein zu sagen und zu uns zu kommen, falls das Nein nicht respektiert wird.»
Wie weit ein Gast gehen kann, ist also sehr abhängig vom Club und der jeweiligen Szene. Der Türsteher vom Franky erzählt zum Beispiel von einer Situation, die er blöd fand: «Da standen zwei Typen vor der Bar, eine Frau geht vorbei und die Typen machen sie ganz normal an. Das darf man ja. Sie reagiert dann aber gleich mit Beschimpfungen. Das finde ich scheisse. Man kann nett nein sagen.» Den Einwand, dass viele Frauen es anstrengend finden, wenn sie auf der Strasse angemacht werden, versteht er, «aber das muss man halt aushalten können.»
Club-Knigge für die Corona-Jugend
Luca steht im Klub Kegelbahn in der Baselstrasse an der Tür. Seine Ausbildung zum Pädagogen hilft ihm bei seiner Arbeit. «Ich bin in meinem Beruf auch mit selbst- und fremdverletzendem Verhalten konfrontiert. Daher bin ich mir einiges gewohnt.» Deshalb setzt er auf Gesprächsführung, Deeskalation und Akzeptanz.

Luca ist Selektor im Klub Kegelbahn und setzt dabei immer auf Gespräche.
Es ist jedoch eine Methode, die nicht immer zielführend ist. Luca von der Kegelbahn ist froh, dass er noch zwei Türsteher hat, die hinter ihm stehen und eingreifen, falls die Situation brenzlig wird: «Sie greifen ein, wenn Gespräche nicht mehr zielführend sind. Manchmal muss man sich körperlich durchsetzen.»
So würden einige Leute aggressiv werden, wenn sie nicht in den Club kommen. «Bei uns sind es vor allem Cis-Männer, die dann wütend werden. FINTA*-Personen verstehen das meistens besser», sagt Luca.
«In Dirndl und Lederhosen kommt man bei uns nicht rein.»
Luca, Selektor Klub Kegelbahn
Er sieht seinen Job auch als Erziehungsarbeit. «Jetzt kommen die ganzen 18-jährigen, die wegen Corona keine Cluberfahrung haben. Denen muss man basic Club-Knigge beibringen», sagt er und seufzt. Das hat im Extremfall auch mit der Kleidung zu tun. «Mit Fastnachtsverkleidung oder in Dirndl und Lederhosen kommt man bei uns nicht rein. Das passt einfach nicht zum Club.» Sonst werde aber nicht nach dem Aussehen selektiert.
Nur am Sonntag frei
Luca von der Kegelbahn ist durch den Ausgang zu seinem Job gekommen. Vor sechs Jahren war er das erste Mal in der Kegelbahn, fing später an, selbst Partys zu organisieren und übernahm darauf die Position vor dem Eingang.
Wege zum Job an der Clubtür gibt es jedoch viele. «Ich bin Ausländer und habe wegen fehlender Arbeitserfahrung in der Schweiz keinen Job gefunden», sagt ein Türsteher vom Schwarzen Schaf an der Frankenstrasse. «Die einzige Möglichkeit war, als Türsteher zu arbeiten.»
Das tut er nun bereits seit 14 Jahren. Das, obwohl er inzwischen Vollzeit in einer Fabrik arbeitet. Denn mittlerweile macht er den Job aber sehr gerne und sieht keinen Grund, damit aufzuhören. Das bedeutet aber auch, dass er nur sonntags frei hat. «Lange schlafen kann ich dann aber nicht. Ich habe eine Familie und muss einkaufen und so.»
Keine Lust auf Ausgang
Als Gäste sind Türsteher*innen aber eher selten in den Clubs anzutreffen. «Ich habe mit 17 angefangen, in den Ausgang zu gehen. Jetzt bin ich 32 und habe nicht mehr so Lust da drauf», so der Türsteher vom Franky. Als Türsteher lerne er Leute kennen und verdiene sogar Geld damit. «Das passt mir gut so.»
Viel Zeit für den Ausgang gibt es denn auch nicht. Ein normaler Arbeitstag an der Tür dauert meist von 22 Uhr bis morgens. Teilweise ist schon um 3 Uhr Schluss, in anderen Fällen geht die Schicht bis 7 Uhr. «Wenn ich fertig bin, bringe ich mein Schichtprotokoll zum Chef ins Roadhouse, wir reden noch ein wenig und gehen dann nach Hause», sagt der Türsteher vom Franky.
«Meistens bin ich nach einer Nacht an der Türe ziemlich geladen.»
Luca, Selektor Club Kegelbahn
Der Austausch am Ende des Abends scheint für alle wichtig zu sein. So auch für Luca von der Kegelbahn. «Nach Schichtende trinken wir alle zusammen ein Bier und reden über den Abend.» Erst dann könne er zuhause Ruhe finden. «Meistens bin ich nach einer Nacht an der Türe ziemlich geladen.»
Und dennoch empfindet er die Baselstrasse längst als sein zweites Zuhause. «Gewisse Leute sieht man immer wieder.» Wie zum Beispiel der Typ, der immer um 03.30 Uhr mit seinem Husky vor dem Club durchspaziert. «Es gibt viele schöne Dinge hier.»