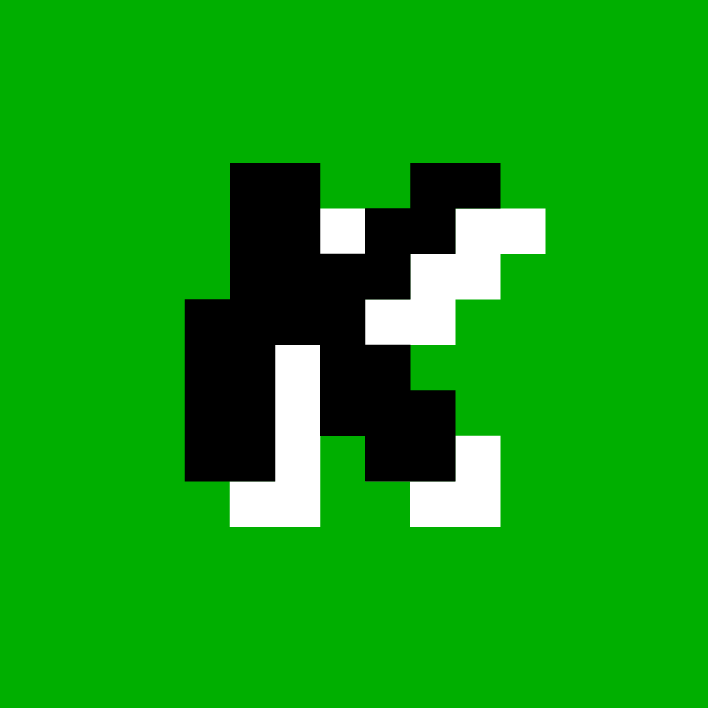Vergewaltigung auf der Bühne
Femizid als Abendprogramm
In Bühnenstücken hat die Misshandlung von Frauen lange Tradition. So auch in der Oper «The Rape of Lucretia», die am Samstag in Luzern Premiere feiert. Muss das sein?
Jana Avanzini — 03/16/22, 04:22 PM

Lucretia-Darstellerin Solenn’ Lavanant-Linke will mit der Inszenierungsart des Opernstücks brechen. (Fotos: zvg)
Die Oper, das sind die grossen Gefühle, leidenschaftliche Beziehungen, tragische Schicksale. Und immer wieder werden Frauen darin ermordet, vergewaltigt, eingesperrt und misshandelt. Oder sie nehmen sich aufgrund von männlichem Fehlverhalten am Ende selbst das Leben.
Beispiele dafür gibt es viele: La Traviata, Carmen, Helena, die Nibelungen, Rigoletto und auch The Rape of Lucretia gehört dazu. Eine Kammeroper über die schöne Lucretia, die vom etruskischen Prinzen Tarquinius vergewaltigt wird und daraufhin Suizid begeht. «Es ist ein Stück über Gewalt und Krieg. Und in seiner Aktualität schwierig aushaltbar», sagt Lars Gebhardt, Co-Operndirektor des Luzerner Theaters, wo das Stück am 19. März 2022 Premiere feiert.
Doch haben wir nicht langsam genug Femizide und Vergewaltigungen von Frauen als Freitagabend-Kulturprogramm zu sehen bekommen? Für Lucretia-Darstellerin Solenn’ Lavanant-Linke geht das Thema weit darüber hinaus. «Jeden Tag gibt es Vergewaltigungen – heute, vor hundert Jahren, vor tausend Jahren – von Menschen aller Geschlechter, von Kindern.» Das müsse thematisiert werden. «Auch in der Kunst», sagt sie.
Fakt ist aber, dass in Opern besonders Frauen oft ganz nebenbei der Handlung zum Opfer fallen. Gebhardt nennt Verdi als Beispiel. In dessen Werke hätte das System. «Sopran und Tenor wollen zusammen ins Bett, der Bariton hat was dagegen. Dann stirbt die Frau. So funktionieren Verdi-Opern.»
Gegen den «male gaze»
Während Frauen in Opern reihenweise das Leben lassen müssen, werden die Täter oftmals als Opfer einer schlechten Welt dargestellt, die sich im Selbstmitleid suhlen dürfen. Ein Narrativ, immer wieder wiederholt, mit dem der Mythos des «Dramas aus Leidenschaft» und dem «Mann als Opfer seiner Triebe» weiter verwertet und reproduziert wird. Gebhardt sieht The Rape of Lucretia dabei jedoch als Ausnahme. Gewalt sei hier kein Beigemüse. «Im Gegenteil. Die Vergewaltigung ist das Thema.»
Das Stück stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Männer schrieben für Männer über Frauenschicksale, getränkt von Klischees. Die Männer ziehen in den Krieg, die Frauen sitzen am Spinnrad. Die Frau ist Hure oder Mutter.

Prinz Tarquinius (Vladyslav Tlushch) kennt kein Nein.
Wie kann man diese Opern auf die Bühne bringen, ohne diese Klischees zu reproduzieren? Beispielsweise, indem Täter in den Fokus stellt werden. Bei Lucretia ein Prinz. «Kein Traumprinz, sondern ein Mann, der aus einem verwöhnten Jungen heranwuchs, der nie ein Nein gehört hat», so Gebhardt. Ein Mann mit Macht, der sich über dem Gesetz sieht, der andere Menschen, Frauen besonders, nicht als Gegenüber, sondern als Objekte wahrnimmt.
Das Publikum muss damit konfrontiert werden, wie es auf die Körper der Darstellerinnen schaut. Der «male gaze», der objektivierende Blick auf die Frau, muss herausgefordert werden. Es braucht Regisseurinnen und Komponistinnen, die solche Themen aus unserer Zeit, mit unseren Fragen, neu betrachten.
Verunglückte Werbung
Die Produktion des Luzerner Theaters will mit der gängigen Inszenierungsart des Stücks brechen. «Man kennt The Rape of Lucretia eigentlich nur in hartem Schwarz-Weiss. Sie ist ein Engel, er ist der Teufel», so Lavanant-Linke. «Lucretia ist in unserer Inszenierung zu Beginn nicht abgeneigt, sie hat Lust auf diesen jungen Mann. Doch als sie ihm klarmachen will, dass sie keinen Sex will, wird ihr Nein nicht gehört.» Es ist also kein Unbekannter, der eine personifizierte Unschuld aus dem Nichts heraus überfällt. Und damit viel stärker eine Auseinandersetzung mit der Realität, in der die Täter meist Partner, Ex-Partner, Bekannte oder Familienmitglieder sind. «Ich glaube, das wird Diskussionen anregen, doch ich bin auch nicht naiv und denke, dass das alle verstehen oder hinterfragen werden», sagt Lavanant-Linke.
«Da wurde unreflektiert die gängige Formulierung wiederholt, das ist schiefgelaufen.»
Solenn’ Lavanant-Linke
Die Bewerbung der Produktion lässt an diesen progressiven Vorsätzen jedoch Zweifel aufkommen. Da heisst es: «Es ist mitten in der Nacht, als er sich an ihr Bett heranschleicht. Er drückt ihr einen Kuss auf ihre Lippen, den sie erwidert, denn sie träumt, es sei ihr Mann. Erst als sie erwacht, begreift sie die Gewalt, die ihr angetan wird.» Damit wird doch genau der voyeuristische Blick des Publikums dahin gelenkt, wie hier eine Frau vergewaltigt wird. Wo bleibt hier die Auseinandersetzung, die so angepriesen wird? «Da wurde unreflektiert die gängige Formulierung wiederholt, das ist schiefgelaufen», gibt Lars Gebhardt zu. Ein neuer Text ist schon aufgeschaltet.
Die Musik erzählt etwas anderes
Die Oper ist quasi traditionell frauenfeindlich. «Viele Texte sind fürchterlich und misogyn», sagt Gebhardt. «Aber sie sind nicht zum Lesen da. Sie funktionieren oft nur mit der Musik darunter, die uns zum Verständnis hilft.» Beispiel Händel: Da reist Orlando in die Hölle und ein Fünfviertel-Takt erklingt. «Das bedeutet für uns heute rein gar nichts mehr. Wir hören die schönen Melodien. Damals jedoch war allen klar, dass er damit lächerlich gemacht wird.» Er singt, wie schlimm die Welt sei. «Aber die Musik erzählt: Er ist ein leidendes Arschloch. Solche Ebenen müssen wir für das heutige Publikum wieder sichtbar machen.»

Solenn’ Lavanant-Linke will alte Opernstücke grundsätzlich nicht verbannen.
Laut der Lucretia-Darstellerin sollte man sich viel öfter fragen, was ein Stück damals ausgelöst hat, gesellschaftlich und politisch. «Es muss versucht werden, eine solche Wirkung wieder herzustellen.» Denn vieles an diesen Werken sei zeitlos. Und diese Kunst wegen veralteten Gedankengutes und Sprache zu verbannen, wäre der falsche Weg, findet Lavanant-Linke: «Wir müssen die Sammlung Rosengart ja auch nicht verbrennen, weil wir jetzt ein Museum für moderne Kunst haben.»
Es ist wie bei Facebook
Die Oper ist eine konservative Kunst. Sie lebt zu grossen Teilen mit und von einem Publikum, dem das Theater zu modern geworden ist. «Lass uns in die Oper gehen, da ist es noch schön», heisst es. Man erwartet Werktreue, Tradition, Reproduktion. «Sie wollen bestätigt werden, in dem, was sie kennen und bereits wissen. Ein gesamtgesellschaftliches Phänomen», so Gebhardt. «Wir gehen in eine Facebook-Gruppe, weil wir genau das lesen wollen, was wir selbst bereits denken.»
Wolle man das Opern-Publikum konfrontieren, müsse man es erst verführen. «Man muss es dort abholen, wo es sich auskennt und wohlfühlt», so Gebhardt. Und dann, im dritten Akt könne man es konfrontieren.