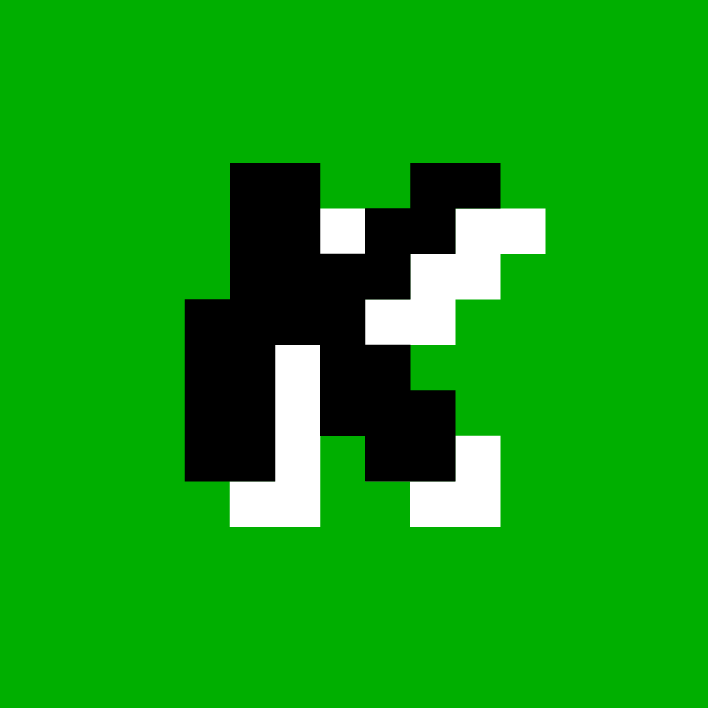Mann ärgere dich nicht
Ein einig Volk von Schwestern
Der Frauen*streik 2021 war tosend, bunt und wild. Er war Wahnsinn. In Nidwalden jedoch ignorierte man die Feminist*innen zu grossen Teilen standhaft.
Jana Avanzini — 06/21/21, 08:59 AM

Es fühlte sich ein bisschen an wie die Revolution. (Illustration: Line Rime)
Als der Frauen*streik vom 14. Juni 2021 zu Ende ging, schmerzten meine Stimmbänder, wir waren auf Statuen geklettert und hatten nackt gebadet. Es war ziemlich legendär.
Wenige Minuten nach dem Start der Demonstration durch Luzern begann es. Der Abend war jung, die Sonne stand noch viel zu hoch. Wir waren tausende weniger als vor zwei Jahren. Doch wir waren tausende – und die Stimmung unfassbar. Ich wurde mitgerissen, von einem Strudel der Euphorie erfasst.
Vor mir tanzten Frauen mit nackten Oberkörpern, hinter mir Kinder auf den Schultern ihrer Mütter und Väter. Geballte Fäuste erhoben sich zu hunderten in absoluter Stille. Es war ohrenbetäubend. Ich tanzte und schrie, ich sang und ich weinte. Wir waren entfesselt.
Ein paar Stunden vorher jedoch sah die Welt ganz anders aus. Ich sass auf dem fein säuberlich gepflasterten Dorfplatz in Stans. Am Winkelried-Denkmal und an der Kirche hingen Transparente, Musik schallte aus den Boxen. Die Stimmung war gemütlich. Wir waren ungefähr 30 Personen, eher jünger als älter, stanzten Buttons und beglitzerten unsere Gesichter und Nägel. Ein älterer Herr drehte seine vierte Runde auf der Strasse an uns vorbei und rief «Kindergarten» herüber. Ein paar Minuten später ging ein Nidwaldner Regierungsrat geschäftig an uns vorbei. Man kennt sich, man mag sich eigentlich und hält sonst immer freundlich Smalltalk. Doch jetzt versuchte er offenbar krampfhaft, uns zu übersehen. Bloss nicht «Hallo» sagen. Auch eine Bekannte, dich mich sonst stets überschwänglichst begrüsst, hatte plötzlich so gar keine Zeit, auch nur mit Gruss an uns vorbeizugehen.
Keine Zeit. Keine Zeit. «Kindergarten!» Eine Passantin, eine der wenigen über vierzig, die sich an den Stand trauten, fasste es später passend zusammen: «Wir werden hier entweder ignoriert oder lächerlich gemacht.» So hält man «aufmüpfige» Frauen klein, und die anderen davon ab, sich mit ihnen zu solidarisieren. Die Angst davor, ausgelacht, nicht ernst genommen zu werden, ist zu gross. Besonders in kleinen Orten. Genau deshalb gibt es hier noch so viel zu tun. Man muss die Leute erstmal dazu bringen, überhaupt mit einem zu sprechen – auf Augenhöhe. Um ihnen dann aufzuzeigen, dass wir hier keine Amazonen-Herrschaft fordern. (Amazonen einer Grossstadt – unbedingt jetzt im Kino schauen.) Dass wir ziemlich normale Menschen sind, die nicht als solche zweiter Klasse behandelt werden wollen.
Es braucht solche Tage, an dem frau sich fühlt, als würde die feministische Revolution anbrechen.
«Und warum schon wieder ein Streik?»
«Müsst ihr denn wirklich jedes Jahr auf die Strasse gehen?»
Ich sage: Ja, das müssen wir. Denn es sind – trotz all der Arbeit, die für so einen Tag aufgebracht wird – Momente des Kräftetankens und des Sich-Starkfühlens. Momente, in welchen wir wieder sehen, dass wir nicht alleine sind. Und das brauchen wir. Denn der Rest, der Rest ist Arbeit: Diskussionen, Fakten aufzählen, Übergriffe und Gewalt aufzeigen, Fakten aufzählen, Übergriffe erleben, lächerlich gemacht werden, Fakten aufzählen – schlicht und einfach deprimierendes Zeug.
Da braucht es zwischenzeitlich solche Tage, an dem frau sich fühlt, als würde gerade die feministische Revolution anbrechen. Als seien wir ein einig Volk von Schwestern.
Oder feministische Geschwister.
Jana Avanzini wurde schon auf dem Schulhausplatz mit dem Spitznamen «Avanze» bedacht. Sie ist Co-Redaktionsleiterin bei Kultz, doch in dieser Kolumne lässt sie sich alle zwei Wochen über die alltäglichen K(r)ämpfe einer Feministin aus. Einer Feministin in der Zentralschweiz, wo man(n) sich noch gerne über aufmüpfige Frauen und Genderwahnsinn ärgert.