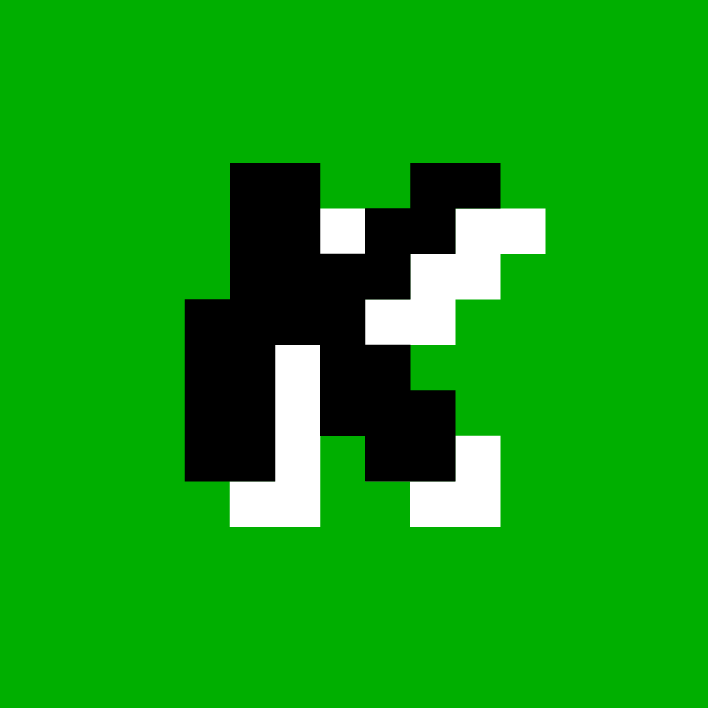Prime Time
Unterwegs im Feindgebiet
Die Stasi war schlimm. Die radikalen Künstler sind schlimmer. «Leander Haussmanns Stasikomödie» ist unterhaltsamer Klamauk, der aber an Orientierungslosigkeit leidet.
Sarah Stutte — 05/22/22, 09:49 AM

Eine witzige Stasi-Komödie mit kleinen Schwächen. (Foto: Constantin Film)
Wir schreiben die 80er-Jahre in der DDR. Ludger Fuchs (David Kross) steht in den ersten Filmminuten sehr lange an einer roten Ampel, trotz menschenleerer Strassen. Die Wartezeit bis Grün überbrückt er, in dem er Jack Kerouac «Unterwegs» liest – das Manifest der unkonventionellen Beat Generation. Das lässt auf den ersten Blick auf eine sensible Künstlerseele schliessen, die sich der Literatur, den wilden Partys und der freien Liebe nicht verschliesst. Erst recht, als er plötzlich ein kleines Kätzchen erspäht, das mitten auf der Strasse sitzt. Ungünstig, da gerade – wie aus dem Nichts – auch noch die Strassenreinigung angefahren kommt. Ludger überlegt fieberhaft, ob er nun das Tier trotz roter Ampel retten soll. So revolutionär scheint der junge Mann dann doch nicht zu sein, eher bürgerlich-linientreu.
Dann Blende in die Neuzeit. Ludger Fuchs (hier Jörg Schüttauf) – nun ein bekannter Schriftsteller – hat gerade seine Stasi-Akte abgeholt und ist auf dem Heimweg. Unter den interessierten Augen aller Familienangehöriger und eines behördlichen Archivars, den seine Frau ohne sein Wissen eingeladen hat, werden die Dokumente gesichtet. Eigentlich wollte Ludger erstmal alleine in die Akte gucken. Das hätte er mal besser tun sollen, weil plötzlich ein schlüpfriger Liebesbrief zum Vorschein kommt. Den hatte Ludger aber nicht an seine Frau geschrieben, mit der er damals schon zusammen war. Das traute Zusammensein wird dadurch jäh gestört.
Danach geht’s wieder zurück an die Ampel. Dort wird enthüllt, dass diese von oberster Stelle kontrolliert wird. Die Katze bei Rot oder Grün zu retten, war ein Stasi-Test, den Ludger natürlich besteht. Flugs wird der neue Genosse vom harschen Oberstleutnant Siemens in eine Sondereinheit berufen, mit dem Ziel, die böse Künstlerszene zu infiltrieren, die sich am Prenzlauer Berg angesammelt hat. Dabei gibt Siemens den Jungspunden noch einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: Sich in Acht zu nehmen vor diesen negativ-Dekadenten, kurz Neg-Deks genannt. Denn schwuppdiwupp würden aufrechte Bürger von ihnen eingelullt.
Genau so passiert es Ludger während der Mission LSD – freilich benannt nach den Namen der Strassen, die das Einsatzgebiet umschliessen. Schon beim Präparieren der ersten Wohnung wird Ludger schwach und schläft mit dem weiblichen Zielobjekt, die im Grunde gar nicht da sein sollte. Weil er dadurch aber den Auftrag nicht auffliegen lässt, wird er befördert und darf weiter im Alleingang Neg-Deks ausspionieren. Dazu bezieht er eine eigene Wohnung und tippt fleissig Stasi-Berichte, bis ihm dann seine freigeistige Nachbarin Natalie über den Weg läuft.
Ziviler Ungehorsam mit ironischem Unterton ist toll, vor allem, wenn über beide Seiten gewitzelt wird.
Mit «Leander Haussmanns Stasikomödie» schliesst der Regisseur seine DDR-Trilogie ab, mit der er 1999 («Sonnenallee») begann und die er 2005 («NVA») weiterführte. Erst beschäftigte er sich mit dem Leben von Jugendlichen in der 70er-Jahre DDR, dann nahm er sich die Nationale Volksarmee in der Endphase der Republik zur Brust und nun bekommt selbstredend noch die Stasi, die natürlich vorher auch schon immer irgendwie vorkommen musste, ganzheitlich ihr Fett weg. Das ist vor allem in den Szenen witzig, in der David Kross als junger Spion zwischen Staatstreue und Bohème-Leben hin-und hergerissen ist. Oder in den vielen Spitzen, welche die Banalität der minuziösen Überwachung offenbaren. Haussmann schöpft hier aus dem Vollen, bis der ganze Planet Absurdistan in eine Reinhard Mey-Musicalnummer kumuliert, die geradezu explosiven Charakter hat.
Dass das alles am Ende nicht so ganz rund geworden ist, liegt vor allem an den Szenen in der Gegenwart, die im Vergleich mit der Haupthandlung stark abfallen. Auch wirft der Film einige Fragen auf, die nicht zufriedenstellend gelöst werden. Generell steht die Frage im Raum, von was für einer Motivation die Hauptfigur und auch der Film getrieben ist. Der Liebesbrief macht am Ende keinen Sinn. Viel spannender wäre es gewesen, Ludgers geheime Stasi-Identität endlich vor seiner Familie aufzudecken. Damit hätte auch das heikle Thema beleuchtet werden können, wie beispielsweise eine Frau damit umgeht, jahrelang vom eigenen Mann beschattet worden zu sein. Doch davor scheut sich der Film. Er bringt lieber einmal mehr Detlef Buck als Oberwachtmeister in Stellung und Beat-Koryphäe Allen Ginsberg (nicht den echten, der ist leider tot!). Letzterer ist Teil eines Moments, in dem die Hippie-Kommune aus einer Banalität einen sozialkritischen Kommentar herausliest, der – einem heutigen Hashtag gleich – dann prompt die Runde macht. Es bleibt dabei: Ziviler Ungehorsam mit ironischem Unterton ist toll, vor allem, wenn über beide Seiten gewitzelt wird. Trotzdem hätte dem Ganzen hier und da ein wenig mehr Fokus sicher gut getan.