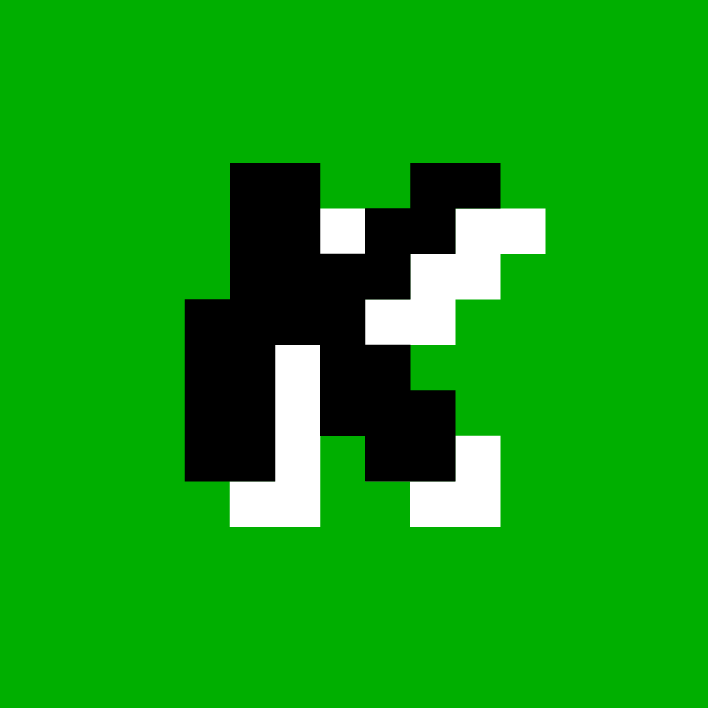Landei versus Stadthuhn
Wirologie im Beet
Unsere Kolumnistin kämpft gegen grausliche Eindringlinge im eigenen Garten. Was mit Rosenquarz, Kruzifix und Contact-Tracing nicht funktioniert, klappt mit akribischer Studie. Bleibt nur noch die Moralfrage.
Christine Weber — 05/04/21, 06:41 AM
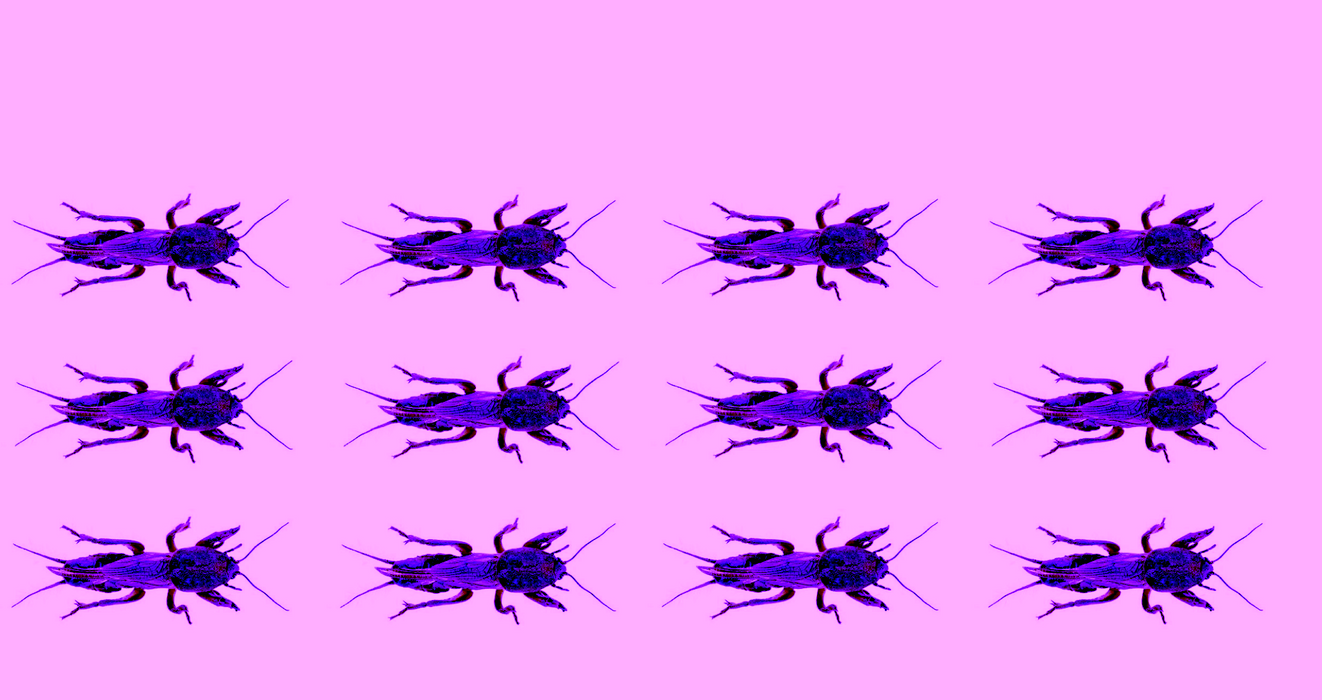
Der Feind im eigenen Beet: Die Maulwurfsgrille.
Wer am Ende der Welt lebt, muss einen Garten haben. Mit Salat und Kartoffeln, mit Ringelblumen und Kohl. Vor den benachbarten Bauernhäusern stehen ausnahmslos Hochbeete – kommt für mich aber nicht in Frage: Schliesslich soll das hier kein szeniges Urban Gardening werden. Mit Enthusiasmus grabe ich also die komplett verwahrlosten Beete um. Bald stösst die Schaufel auf Metall.
Schatzkiste? Nein! Eine von mehreren Blechplatten, die unter der Oberfläche vergraben sind. Ich wundere mich - doch wie man hört, soll der frühere Besitzer ein Kauz gewesen sein. Die riesigen Platten werden ausgebuddelt, die Beete angelegt. Dann pflanze ich Salat, Zwiebeln und Kohlrabi. Dabei stosse ich auf zehn Rosenquarze und mehrere kleine Kruzifixe. Muss wirklich ein sehr seltsamer Kauz gewesen sein, der alte Mann.
Es wird warm. Das Gemüse wächst. Ich bin stolz. Bis das erste Blatt eines Kohlrabi schlapp macht. Und das nächste und nächste. Wenn ich dran zupfe, flutscht der Setzling ohne Wurzel heraus. «Wiris», sagt eine Nachbarin beiläufig im Vorbeigehen. Wiris? Ich schaue im Internet nach. Werren. Maulwurfsgrillen. Grausliche Science-Fiction-Viecher! Zehn Zentimeter lang, dick und braun. Nachts graben sie Gänge und zerstören im vorbeirobben Knollen und Wurzeln.
Ich bin nicht zur Kapitulation bereit. Nematoden werden ausgesetzt: 50 Millionen Fadenwürmchen kriechen in die Erde. Sie schaffen es nicht, die Viecher zu bodigen. Weiter geht’s mit Contact-Tracing, damit kennt man sich jetzt aus: Den Finger in die Löcher stecken, den meterlangen Gängen folgen, die Abzweigungen zerstören und die Ausbreitung unterbrechen. Am nächsten Tag sind die Löcher wieder da, hängen die Kohlrabi-Blätter wieder schlapp herum. Nicht aufgeben! Mein Garten soll weder Hochbeet sein, noch Blechplatten eingepflanzt haben.
Nachts setze ich mich ans Beet, mache Notizen über die häufigsten Routen und studiere das Verhalten der Wiris. Wirologie eben. Dann bastle ich passende Fallen und platziere sie an den neuralgischen Stellen. Die erste Werre tappt rein. Die nächsten Tage tüftle ich an Verbesserungen: Ich wechsle die Farbe der Fallen (halbierte Plastikbecher) und lege Hölzchen als Leitplanken für den Weg ins Verderben. Es funktioniert!
Zehn Fallen sind aufgestellt, jeden Morgen klaube ich bis zu fünf Werren mit der Grillzange heraus und stecke sie in einen Kübel. Was ich nachher mit den Tieren mache, will ich selber nicht wissen. Doch zur Rehabilitierung meines Karmas muss ich ganz bestimmt jede Menge Rosenquarze und Kruzifixe vergraben – vielleicht ist es ja das, was der kauzige Vorgänger damit bezweckt hatte.
Meine Freundin aus Luzern sagt: Was auf dem Land Wirologie im Beet ist, ist im urbanen Raum Virologie im Bett. Beides ist mühsam.
Christine Weber hat sich nach über vier Jahrzehnten aus dem turbulenten Stadtleben verabschiedet und lebt seit einem Jahr dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen: Im hintersten Teil von Obwalden. In der Kolumne «Landei versus Stadthuhn» wirft sie einen (selbst)ironischen Blick auf die Klischees von urbanem Lifestyle und hinterwäldlerischer Verstocktheit. |